

© Anton Prock 2016
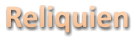
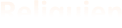
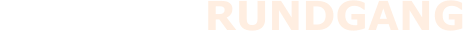
Unter Reliquien (lat. reliquiae = Überreste,
Überbleibsel) versteht man die Reste von
Märtyrern, Seligen und
Heiligen,
aber auch Dinge, die diese Menschen in
ihrem Leben benützt haben, wobei für die
Gläubigen diese Reste stellvertretend für
sie stehen.
Man unterscheidet zwischen
•
Primär- oder Körperreliquien
(Knochen, Haare, Zähne, Nägel oder
Asche von Heiligen)
•
Sekundärreliquien (Dinge, die ein Heiliger benutzte, etwa Kleidungsstücke, Schuhe, Kreuz etc.)
•
Tertiärreliquien (Gegenstände, die mit der Körper eines Heiligen nach seinem Tod berührt wurde,
etwa Tücher, Zettel u. a.).
Die Verehrung von Reliquien von Märtyrern
hat schon im 2. Jh. begonnen. Die frühen
Christen haben ihre Gottesdienste über den
Gräbern der ersten Heiligen gefeiert. Auch
heute befindet sich in jedem
Altar, an dem
eine
Messe gefeiert wird, mindestens eine
Reliquie.
Auslöser für die Verehrung von Reliquien waren
religiöse, machtpolitische und wirtschaftliche
Beweggründe.
Indem der Gläubige Reliquien sehen, berühren oder küssen konnte, wurden menschliche Sorgen und
Probleme an den Heiligen übermittelt. Die Heiligen galten als Übermittler unserer Gebete und
Anliegen bei Gott, denn zu Gott hatten die Menschen keinen direkten Zugang. Aufgrund ihres
vorbildhaften Lebens sind sie nach ihrem Tod sofort in den Himmel eingegangen. Die wichtigste Heilige
ist
Maria, die Mutter Jesu.
Von Reliquien gingen Segen und Heil aus. Wer in der Nähe von Reliquien
lebte, betete oder bestattet war, sah sich des Schutzes und der Fürbitte
des verehrten Heiligen sicher.
Reliquien wurden früher gesammelt und in kostbaren Behältnissen, den
Reliquiaren, aufbewahrt, denn die Reliquienverehrung nahm einen
besonderse Stellung in der katholischen Religion ein. Je mehr Reliquien
jemand besaß, desto mehr Fürbitter hatte er bei Gott und desto sicherer
war der Weg in den Himmel. Zudem herrschte auch der Glaube, dass
der Besitzer einer Reliquie die geistige Kraft des Verstorbenen
übernehmen könne. Die Reliquien bzw. die Heiligen galten als die
„Doktoren des Mittelalters“ und jedem Heiligen wurden heilende Kräfte zugesprochen. Da die Medizin
wenig auszurichten vermochte, blieben den Gläubigen nur die Heiligen. Für alle Anliegen, Situationen
und Dinge des Lebens war ein Heiliger zuständig. Wunder ereigneten sich meist direkt an
Wallfahrtsorten. In diesem Zusammenhang ist auch das
Wallfahrts- und Pilgerwesen zu sehen.
Die Menschen des Mittelalters glaubten, dass Reliquien vor
bösen Geistern und dem
Teufel sowie vor Krankheiten
schützten und ihrem Besitzer Ansehen, Wohlstand und Macht
verschaffen konnten. In fast jeder Kirche wurde eine Reliquie
verehrt. Im Turiner Dom wollten die Gläubigen das Grabtuch
Christi sehen, in Aachen verehrte man ein Lendentuch Christi und
ein Gewand von Johannes dem Täufer. Solche Reliquien lockten
zahlreiche Gläubige an, die sich wahre Wunderdinge von den
Resten der Heiligen versprachen. Herrscher sammelten Reliquien
um damit nachzuweisen, dass sie in der Gnade Gottes standen.
Es bildete sich ein intensiver Reliquienhandel aus. Kleine Schreine mit Erde aus dem Heiligen Land,
Fläschchen mit Blut, das angeblich von einem heiligen Leichnam stammte, und ähnliche Reliquien
wurden Massenware. Der betrügerische Handel blühte. Die Kirche verurteilte zwar teilweise den
Reliquienhandel und verbot ihn
zeitweise, machte aber großen
Profit damit.
Wallfahrten und Pilgerfahrten
zeigten auch wichtige
wirtschaftliche Aspekte. Durch die
Gewinnung von
Ablässen wurde der Wallfahrtstourismus auch ein einträgliches Geschäft für
Wallfahrtsorte,
Klöster, Kirchen. Unter Ablass versteht man den teilweisen oder vollständigen
Nachlass von Sündenstrafen aufgrund von guten Werken. Meist war damit auch die Abgabe von
Almosen verbunden.

















- Ablass
- Abtei
- Acht - Achteck
- Adler
- Ähre
- Akanthus
- Alpha und Omega
- Altar
- Altare privilegiatum
- Ambo
- Anker
- Antependium
- Apfel
- Apokalypse des Johannes
- Apostel
- Apostelkreuze
- Apsis
- Arme Seelen
- Baldachin
- Bandelwerk
- Baptisterium
- Barmherzigkeit, Werke der
- Basilika
- Beichtstuhl
- Bergpredigt
- Bibel
- Bischof
- Blattgold
- Bruderschaft
- Buch
- Chor
- Chorgestühl
- Christus
- Christusmonogramm
- Chronogramm
- Delphin
- D.O.M.
- Dom
- Dornenkrone
- Drache
- Dreieck
- Dreifaltigkeit

- Engel-Putti
- Engelchöre
- Epitaph
- Erzbischof
- Eucharistie
- Evangelisten
- Ewiges Licht
- Fackel
- Fahne
- Farben - Liturgie
- Farbsymbolik
- Fegefeuer
- Fensterrose
- Feuer
- Fisch
- Flügelaltar
- Frauenseite
- Fresko
- Friedhof
- Gebetshaltung
- Gericht
- Getreideähre
- Glas
- Glasmalerei - Glasfenster
- Globus
- Glocken
- Gnadenstuhl
- Gold
- Göttliche Tugenden
- Grab, Grabmal, Grabstein
- Guter Hirte

- Kalvarienberg
- Kanzel
- Kapelle
- Kardinaltugenden
- Katakomben
- Kartusche
- Kasel
- Kathedrale
- Kelch
- Kenotaph
- Kerze
- Kirche-Kirchenbau
- Kirchenbänke
- Kirchenbann
- Kirchenjahr
- Kirchenschiff
- Kirchenväter
- Kleriker
- Kloster
- Kniebeuge
- Kreis
- Kreuz
- Kreuzformen
- Kreuzwegstationen
- Krippe
- Kugel
- Lamm
- Laster
- Lauretanische Litanei
- Licht
- Lilie
- Liturgie
- Liturgische Farben
- Liturgische Gewänder
- Löwe

- Sakramente
- Sakristei
- Sakristeiglocke
- Sarkophag
- Schaf
- Schiff-Kirchenschiff
- Schlange
- Schlüssel
- Schlussstein
- Schwert
- Seccomalerei
- Seele
- Seelgerät
- Selige
- Segensgestus
- Seligpreisungen
- Skulptur
- Sonne
- Sonnenuhr
- Stab
- Statue
- Steinmetzzeichen
- Stier
- Stift
- Stifterbildnis
- Stiftung
- Stuck
- Stufen
- Tabernakel
- Taube
- Taufbecken - Taufstein
- Taufkirche
- Tempel
- Tetramorph
- Teufel
- Tiara
- Tod
- Todsünden
- Tore
- Totenschild
- Totentanz
- Trinität
- Tugenden
- Tumba
- Türen








