

© Anton Prock 2016
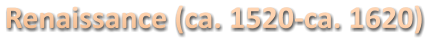

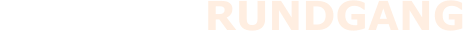
Auf die Gotik folgt die Renaissance, in Österreich von ca. 1520 bis
ca. 1620 vertreten. Ausgangsland dieses Stils ist Italien mit dem
Zentrum Florenz, wo der neue Stil schon ab ca. 1400 zu finden ist.
In Österreich spielt die Renaissance jedoch keine bedeutende
Rolle. Es entstehen nur wenige Bauwerke, etwa Schloss Ambras
und die Hofkirche mit dem Franziskanerkloster in Innsbruck, die
Schallaburg in Niederösterreich, Schloss Porcia in Kärnten, die
Landhäuser in Klagenfurt und Linz etc. Allerdings finden sich vor
allem bei Fenstern und Portalen Einzelelemente der Renaissance
wie etwa kreisrunde Formen, Dreieckgiebel etc.
Das Wort Renaissance bedeutet Wiedergeburt der Antike, wobei
es nicht um eine Nachahmung der Antike geht, sondern um eine intensive Auseinandersetzung mit
ihr und um Neuinterpretation und Umsetzung
antiker Elemente. Erinnerungen an das römische
Imperium und die Größe der Griechen zeigen sich
in Triumphzügen, Siegesfeiern, Grabmonumenten,
tempelähnlichen Gebäuden, Verherrlichung
weltlicher Macht, Ehrenpforten etc. In diesem
Zusammenhang ist auch Kaiser Maximilian I. mit
seinen Stammbäumen und seiner Grabmalsidee
zu sehen. Er steht am Übergang vom Mittelalter
zur Neuzeit, von der Gotik zur Renaissance.
Wissenschaft und Forschung sowie das neu
erweckte Interesse an der Antike bringen viel
Neues. Erfindungen (nautische Geräte für die
Seefahrt, Brille, Glasspiegel, technische Geräte,
Buchdruck etc.), die Wiederentdeckung
Amerikas und die Entdeckung anderer Gebiete in
Übersee kennzeichnen das 15. und 16. Jh. Von
großer Bedeutung war auch die erste
Weltumsegelung des Portugiesen Magellan von
1519 bis 1521. Die Gelehrten setzen sich mit
antiken Schriften auseinander.
Erstmals ist eine starke Verweltlichung zu bemerken. Das diesseitige Leben wird viel stärker betont,
der Glaube ist noch sehr wichtig, verliert jedoch an Bedeutung.
Für die geistlichen und weltlichen Fürsten stehen prunkvolle
Feste, die Errichtung monumentaler Bauwerke, Luxus und
gesteigerter Lebensgenuss im Vordergrund. Zahlreiche
Fürsten setzen sich intensiv auf vielfältige Weise mit der
Antike auseinander, vor allem in Literatur und Kunst. Es ist
eine starke Sammlerliebe zu verzeichnen: Porträts,
Rüstungen, antike Kunstwerke, technische Geräte, allerlei
Kurioses und Ungewöhnliches aus der Natur. Erzherzog
Ferdinand II. legte in Schloss Ambras bei Innsbruck eine
großartige Sammlung an und gilt als einer der ersten
bedeutenden Museumssammler.
Italienischer Einfluss zeigt sich nicht nur in der Architektur,
sondern auch in Malerei und Plastik. Wichtig ist der direkte
Import aus Italien.
Neben den religiösen Bauwerken treten die profanen stärker in den Vordergrund. Neben dem
Bürgerhaus gewinnt vor allem der Schloss- und Palastbau an Bedeutung.
In der Architektur zeigt sich eine deutliche Tendenz
zu Vereinheitlichung und zu monumentaler Wirkung
sowie zu strenger Gliederung. Die Breitendimension
wird gesteigert. Klar lässt sich eine starke
Horizontalität und Vertikalität bemerken.
Verzierungen werden sehr sparsam verwendet,
weshalb die Architektur nüchtern und streng wirkt.
Antike Architekturelemente wie Säulen,
Kassettendecken, Elemente von Tempeln treten auf.
Bei der Malerei finden Themen aus der griechischen
und römische Mythologie Verwendung.
Besonders wichtig ist das Streben nach
Regelmäßigkeit. Die Einzelteile in der Architektur
sind nach gesetzmäßigen Proportionen zu einem
harmonischen Ganzen zusammengefügt. Für die
dadurch entstehende Harmonie ist vor allem der
von der Natur vorgegebene Goldene Schnitt
ausschlaggebend. Werden aus diesem Ganzen
Einzelteile herausgenommen oder verändert, ist
die Harmonie gestört.
Die Renaissance ist auch die große Epoche des
Zentralbaus, wobei der Kreis als Grundriss bevorzugt wird. Da beim Kreis alle Punkte vom Mittelpunkt
gleich weit entfernt sind und der Kreis keinen Anfang und kein Ende hat, symbolisiert er
Vollkommenheit und damit das Göttliche. Dies
manifestiert sich häufig in Kirchen, die Maria, der
Muttergottes und der vollkommenen Frau, geweiht
sind. Als Beispiel kann die Kirche Mariahilf in
Innsbruck genannt werden, die allerdings schon
dem Barock angehört.
Zwischen
Renaissance und
Barock ist noch der
MANIERISMUS
anzusetzen. Es handelt sich dabei um eine Stilepoche, bei der es vor
allem um Verfremdung geht, um eine Störung der in der Renaissance
verbreiteten Harmonie. Architekturelemente werden verzerrt,
verkürzt, überlängt, bei Bildern werden Körper ungewöhnlich verdreht
und verunklärt. Ein Beispiel manieristischer Architektur ist das Äußere
der Karlskirche Volders.












- Ablass
- Abtei
- Acht - Achteck
- Adler
- Ähre
- Akanthus
- Alpha und Omega
- Altar
- Altare privilegiatum
- Ambo
- Anker
- Antependium
- Apfel
- Apokalypse des Johannes
- Apostel
- Apostelkreuze
- Apsis
- Arme Seelen
- Baldachin
- Bandelwerk
- Baptisterium
- Barmherzigkeit, Werke der
- Basilika
- Beichtstuhl
- Bergpredigt
- Bibel
- Bischof
- Blattgold
- Bruderschaft
- Buch
- Chor
- Chorgestühl
- Christus
- Christusmonogramm
- Chronogramm
- Delphin
- D.O.M.
- Dom
- Dornenkrone
- Drache
- Dreieck
- Dreifaltigkeit


- Engel-Putti
- Engelchöre
- Epitaph
- Erzbischof
- Eucharistie
- Evangelisten
- Ewiges Licht
- Fackel
- Fahne
- Farben - Liturgie
- Farbsymbolik
- Fegefeuer
- Fensterrose
- Feuer
- Fisch
- Flügelaltar
- Frauenseite
- Fresko
- Friedhof
- Gebetshaltung
- Gericht
- Getreideähre
- Glas
- Glasmalerei - Glasfenster
- Globus
- Glocken
- Gnadenstuhl
- Gold
- Göttliche Tugenden
- Grab, Grabmal, Grabstein
- Guter Hirte


- Kalvarienberg
- Kanzel
- Kapelle
- Kardinaltugenden
- Katakomben
- Kartusche
- Kasel
- Kathedrale
- Kelch
- Kenotaph
- Kerze
- Kirche-Kirchenbau
- Kirchenbänke
- Kirchenbann
- Kirchenjahr
- Kirchenschiff
- Kirchenväter
- Kleriker
- Kloster
- Kniebeuge
- Kreis
- Kreuz
- Kreuzformen
- Kreuzwegstationen
- Krippe
- Kugel
- Lamm
- Laster
- Lauretanische Litanei
- Licht
- Lilie
- Liturgie
- Liturgische Farben
- Liturgische Gewänder
- Löwe


- Sakramente
- Sakristei
- Sakristeiglocke
- Sarkophag
- Schaf
- Schiff-Kirchenschiff
- Schlange
- Schlüssel
- Schlussstein
- Schwert
- Seccomalerei
- Seele
- Seelgerät
- Selige
- Segensgestus
- Seligpreisungen
- Skulptur
- Sonne
- Sonnenuhr
- Stab
- Statue
- Steinmetzzeichen
- Stier
- Stift
- Stifterbildnis
- Stiftung
- Stuck
- Stufen
- Tabernakel
- Taube
- Taufbecken - Taufstein
- Taufkirche
- Tempel
- Tetramorph
- Teufel
- Tiara
- Tod
- Todsünden
- Tore
- Totenschild
- Totentanz
- Trinität
- Tugenden
- Tumba
- Türen

















