

© Anton Prock 2016

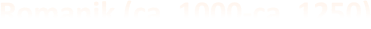
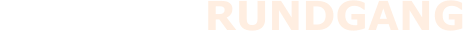
Der erste große Stil der abendländischen Kunstgeschichte ist die
Romanik, die in Österreich von ca. 1000 bis ca. 1250 auftritt. Davor
sind die karolingische und die ottonische Kunst anzusetzen, für
welche der Begriff Vorromanik verwendet wird.
Die Zeit um 1000 ist gekennzeichnet vom damals erwarteten
Weltuntergang. Krieg, Hungersnöte, Missernten,
Naturkatastrophen, Klimaänderung u. a. beeinflussen das Leben der
Menschen in großem Maß. Sie sehen darin die Strafe Gottes für
ihre Sünden, tun Buße und wollen ihr Leben ändern. Dazu kommen
schwere Arbeit, Leibeigenschaft, Knechtschaft, Krankheit, Angst vor
der Natur und dem Tod.
Die Religion spielt eine außerordentlich wichtige Rolle von der
Geburt bis zum Tod. “Was sagt Gott dazu?” ist die übergeordnete Frage, die das ganze Leben betrifft.
Ständig setzt sich der Mensch mit der Frage auseinander, was nach seinem Tod sein wird. Die Religion
schüchtert die Menschen ein, macht ihnen
Angst, ist aber auch das große Auffangbecken
für alle Armen und Notleidenden. Sie nimmt
sich der Armen, Kranken, Alten, Witwen und
Waisen an und gibt ihnen Hoffnung.
Massenbauten, wuchtige Formen, dicke
Mauern, kleine Fenster- und Türöffnungen,
Wehrhaftigkeit sind die Hauptkennzeichen der
romanischen Architektur.
Im sakralen (kirchlichen) Bereich finden wir
Kirchen, Kapellen, Dome (Bischofskirchen) und Klöster, im profanen (weltlichen) Bereich Burgen und
Wohnhäuser. Berühmte Kirchen sind etwa in St. Paul im Lavanttal (Kärnten), in Gurk (Kärnten) und in
Innichen (Südtirol).
Bei Kirchenbauten wird gerne von Gottesburgen gesprochen. Sie
sind wir Burgen gestaltet, die das Böse vom Inneren abhalten
sollen. Vor allem der Westen, die Zone des Bösen, der Geister und
Dämonen, des Todes, wird wehrhaft gestaltet.
Häufig wird der Basilikastil verwendet, eine von der Antike
übernommene Form mit einem erhöhten Mittelschiff und
niedrigeren Seitenschiffen. Säulen und/oder Pfeiler trennen das
Mittelschiff von den Seitenschiffen.
Bei den großen Kirchen finden sich Trichter- oder Gewändeportale, die trichterförmig zur Kirchentür
führen. Ein schönes Beispiel ist das Portal der ehemaligen Stiftskirche Millstatt in Kärnten.
Burgen werden als Sitz von Adelsfamilien
gebaut, die häufig im Auftrag des
Landesfürsten ein Stück Land verwalten, für
Ruhe, Recht und Ordnung sorgen, Steuern
eintreiben und im Kriegsfall Soldaten stellen.
Meist sind diese Adeligen vom Landesfürsten
abhängig, erreichen aber oft im Laufe der Zeit
Eigenständigkeit.
Wohnhäuser aus Stein gibt es vor allem in den
Städten, obwohl Holz noch das übliche
Baumaterial ist. Erst ab dem 14. Jh. treten in
den Städten immer mehr Steinbauten auf, was
auch mit der steigenden Feuersgefahr in dicht verbauten Gebieten zusammenhängt.












- Ablass
- Abtei
- Acht - Achteck
- Adler
- Ähre
- Akanthus
- Alpha und Omega
- Altar
- Altare privilegiatum
- Ambo
- Anker
- Antependium
- Apfel
- Apokalypse des Johannes
- Apostel
- Apostelkreuze
- Apsis
- Arme Seelen
- Baldachin
- Bandelwerk
- Baptisterium
- Barmherzigkeit, Werke der
- Basilika
- Beichtstuhl
- Bergpredigt
- Bibel
- Bischof
- Blattgold
- Bruderschaft
- Buch
- Chor
- Chorgestühl
- Christus
- Christusmonogramm
- Chronogramm
- Delphin
- D.O.M.
- Dom
- Dornenkrone
- Drache
- Dreieck
- Dreifaltigkeit


- Engel-Putti
- Engelchöre
- Epitaph
- Erzbischof
- Eucharistie
- Evangelisten
- Ewiges Licht
- Fackel
- Fahne
- Farben - Liturgie
- Farbsymbolik
- Fegefeuer
- Fensterrose
- Feuer
- Fisch
- Flügelaltar
- Frauenseite
- Fresko
- Friedhof
- Gebetshaltung
- Gericht
- Getreideähre
- Glas
- Glasmalerei - Glasfenster
- Globus
- Glocken
- Gnadenstuhl
- Gold
- Göttliche Tugenden
- Grab, Grabmal, Grabstein
- Guter Hirte


- Kalvarienberg
- Kanzel
- Kapelle
- Kardinaltugenden
- Katakomben
- Kartusche
- Kasel
- Kathedrale
- Kelch
- Kenotaph
- Kerze
- Kirche-Kirchenbau
- Kirchenbänke
- Kirchenbann
- Kirchenjahr
- Kirchenschiff
- Kirchenväter
- Kleriker
- Kloster
- Kniebeuge
- Kreis
- Kreuz
- Kreuzformen
- Kreuzwegstationen
- Krippe
- Kugel
- Lamm
- Laster
- Lauretanische Litanei
- Licht
- Lilie
- Liturgie
- Liturgische Farben
- Liturgische Gewänder
- Löwe


- Sakramente
- Sakristei
- Sakristeiglocke
- Sarkophag
- Schaf
- Schiff-Kirchenschiff
- Schlange
- Schlüssel
- Schlussstein
- Schwert
- Seccomalerei
- Seele
- Seelgerät
- Selige
- Segensgestus
- Seligpreisungen
- Skulptur
- Sonne
- Sonnenuhr
- Stab
- Statue
- Steinmetzzeichen
- Stier
- Stift
- Stifterbildnis
- Stiftung
- Stuck
- Stufen
- Tabernakel
- Taube
- Taufbecken - Taufstein
- Taufkirche
- Tempel
- Tetramorph
- Teufel
- Tiara
- Tod
- Todsünden
- Tore
- Totenschild
- Totentanz
- Trinität
- Tugenden
- Tumba
- Türen

















